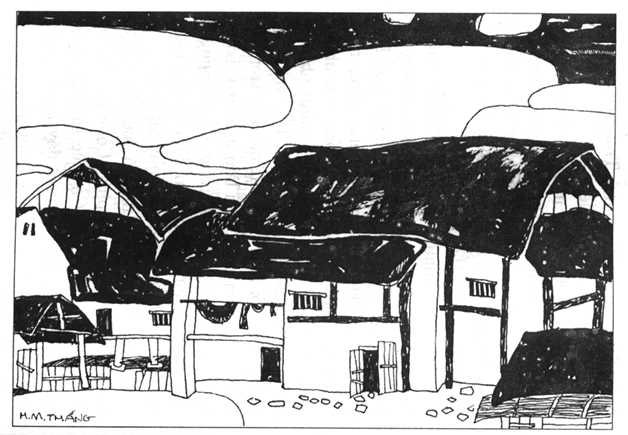
Zehn Begebenheiten aus dem kleinen Bergdorf Hua Tat
von Nguyen Huy Thiep
Im nordwestlichen Hochland, etwa eine Meile1 vom Fuße des Chieng Dong Gebirgspasses entfernt, liegt Hua Tat, ein kleines Bergdorf der Schwarzen Thai2.
Rundherum von Bergen umgeben, ist Hua Tat eingebettet in ein schmales, langgezogenes Tal, an dessen Ende sich ein kleiner See befindet, dessen Wasser nie austrocknet. Wenn der Herbst kommt, erblühen rings um den See wilde Chrysanthemen in so goldener Pracht, daß die Augen schmerzen.
Viele Pfade führen aus dem Tal von Hua Tat hinaus. Der mit Steinen gepflasterte Hauptweg ist breit genug für einen Büffel. Zu beiden Seiten drängen sich üppig me loi3, Bambus, Mangostan, Mangobäume und hunderte Arten von Lianen, deren Namen man nicht kennt. Viele Menschen haben diesem Weg ihre Fußspuren eingeprägt, sogar die eines Kaisers sollen darunter sein, sagt man.
Das Tal von Hua Tat bekommt wenig Sonne: Das ganze Jahr über wabert hier ein dichter silberner Nebel, so daß Menschen und Tiere nur in undeutlichverwaschenen Umrissen grob auszumachen sind. Diesem Nebel entspringen Märchen und geheimnisvolle Legenden und Mythen.
Viele alte Geschichten sprießen in Hua Tat wie diese Wildblumen, die mit ihren goldenen, knopfkleinen Blüten überall die schmalen Gassen säumen. Männer, die diese Blumen im Mund behalten, macht Alkohol nicht betrunken. Die alten Geschichten gleichen auch den weißen Steinen mit der roten, feinen Maserung, die auf dem Grund der Bäche verborgen liegen. Die Frauen mögen diese Steine. Sie sammeln sie auf und wickeln sie für hundert Tage in ihr Unterhemd. Wenn sie dann das Nachtlager für ihren Mann herrichten, verstecken sie diese Steine darin. Von alters her weiß man, daß der Mann auf einer solchen Matratze nie von einer anderen Frau träumt.
Hua Tat ist ein kleines, abgeschiedenes Dorf. Die Bewohner führen ein einfaches, naturverbundenes Leben. Die Feldarbeit in den Bergen ist mühsam und erschöpfend, und genauso verhält es sich mit der Jagd. Aber die Leute hier sind sehr großherzig und gastfreundlich.
Wenn ein Besucher nach Hua Tat kommt, wird er in den Kreis ums Feuer gebeten und eingeladen, mit einem Röhrchen Reiswein aus einem Krug zu trinken4 und dazu einen Streifen Dörrfleisch eines wilden Tieres zu essen. Einem rechtschaffenen Gast wird das Familienoberhaupt Gelegenheit geben, einer der alten Legenden zu lauschen. Es mag sein, daß viele dieser alten Geschichten oft von dem Elend der Menschen erzählen, aber wenn wir diese Not wirklich deutlich verstehen, wird sich aus diesem Verstehen heraus ein edelmütiges Herz entfalten.
Die Menschen dieser alten Geschichten von Hua Tat leben heute nicht mehr. Sie sind ganz und gar zu Asche und Staub geworden.5 Jedoch ihre Seelen flimmern immer noch über den khau cut6 der Pfahlhäuser.
Wie die Winde.
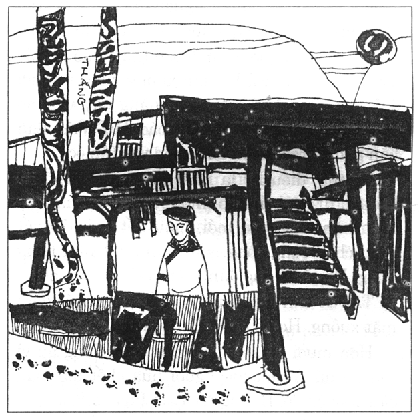
Die erste Geschichte:
In jenen Tagen lebte in Hua Tat ein Mädchen namens Pua. Im ganzen muong7 kam ihr niemand an Schönheit gleich, mit ihrer Haut, die so weiß war wie ein frisch gepelltes Ei, ihrem langen und glänzenden Haar, ihren zinnoberroten Lippen. Nur einen Fehler hatte Pua: sie war an beiden Beinen gelähmt, Monat für Monat, Jahr für Jahr, lag sie auf dem gleichen Fleck.
Zum Zeitpunkt dieser Ereignisse war Pua sechzehn Jahre alt. Sechzehn ist das Alter des Frühlings, der Liebe. Vielleicht gibt es mehrere Liebesgeschichten, aber der Frühling eines jungen Mädchens kommt nur einmal. Mit dem sechzehnten Lebensjahr beginnt der Frühling, mit dem neunzehnten kann schon der Herbst gekommen sein.
Der Frühling in Hua Tat ist erfüllt vom Ton der Flöten8. Die Flöten ertönten rund um das Haus und bei den quanPfählen9 eines jeden unverheirateten Mädchens. Kein Grashalm kann dort wachsen, und die ausgelaugte Erde war ganz eben und glatt.
Rund um Puas Haus hörte man keine Flöten. Niemand nimmt eine Lahme zur Frau. Alle bedauerten Pua. Die Leute brachten für sie Opfergaben dar und suchten nach einer Medizin. Aber alles war vergeblich, Puas Beine blieben steif.
In jenem Jahr durchlitt Hua Tat einen furchtbaren Winter. Der Himmel war völlig verwandelt, die Pflanzen verdorrten unter dem Rauhreif, Wasser gefror, und im Wald von Hua Tat trieb ein entsetzlicher Tiger sein Unwesen. Tag und Nacht strich der Tiger um das Dorf herum. Völlig menschenleer schien es dazuliegen, niemand traute sich hinaus aufs Feld. Abends wurde jeder Treppenaufgang sorgfältig mit Dornenzweigen versperrt und verrammelt, jede Haustür fest verriegelt. Jeden Morgen fand man die Spuren der Tigertatzen um jedes einzelne Haus herum. Das ganze Dorf lebte in tiefer Furcht.
Es ging das Gerücht, daß der Tiger ein völlig unnatürliches Herz habe, ein Herz wie aus Kieselstein und dabei ganz durchsichtig. Dieses Herz sei ein mächtiger Talisman und eine übernatürliche Medizin. Wer dieses Herz besitze, werde sein ganzes Leben lang reich und glücklich sein. In Alkohol eingelegt, könne dieses Herz jede noch so schwere Krankheit heilen. Sogar Puas gelähmte Beine könnten durch diese Medizin gesunden. Gerüchte gleichen den Sperbern, die unvermittelt auf den Grund hinunter stoßen. Am Küchenfeuer, auf dem Hof unter den Hauspfählen, unten am Bachufer, oben auf den Feldern in den Bergen, einfach überall sprachen die Menschen über das Herz des Tigers. Sogar hinunter ins Flachland, in die Siedlungsgebiete der Kinh und hinauf in die höchsten Berggipfel, wo die Mong10 leben, drang das Gerücht vor.
Mit Gerüchten verhält es sich so: Von den Lippen der Unwissenden erscheint alles als sonderbar und außergewöhnlich, was im Mund bewanderter Menschen lediglich interessant klingt. Sehr viele Menschen kamen, um den Tiger zu jagen, Thai, Kinh, Mong … Die einen jagten ihn, um sein Herz als Talisman zu erbeuten, andere wollten es als Medizin. Wer könnte sie tadeln? Wer hat denn in seinem Leben noch niemals Vergänglichem nachgejagt?
Die größte Gruppe unter den Jägern stellten die jungen Männer aus Hua Tat. Sie wollten das Tigerherz, um Pua zu von ihrer Krankheit zu kurieren.
Die Tigerjagd zog sich den ganzen Winter hin. Als besitze er übernatürliche Kräfte, wußte der kluge Tiger die Stellen zu meiden, an denen die Jäger ihn versteckt erwarteten. Die Jäger wurden zu Gejagten. Viele Menschen11 starben durch den entsetzlichen Tiger. Ununterbrochen zogen Klagelaute zusammen mit dem Heulen des Windes durch das Dorf. Nach und nach verloren die Leute den Mut und gaben verzagt auf, und schnell wie die reifen MangostanFrüchte vom Baum fiel die Zahl der Jäger, bis am Ende nur noch einer übrig war. Das war Kho.
Kho war ein Junge aus Hua Tat. Er war Waise, und er lebte wie ein don-dim-Tier12. Don-Dim-Tiere führen ein einsames Leben, sie folgen ihren eigenen Pfaden, und niemand weiß, wie sie sich ernähren. Nie beteiligte sich Kho an den Zusammenkünften und Festen des Dorfes. Zum Teil war das auf seine Armut zurückzuführen, zum Teil auf seine Häßlichkeit. WindpockenNarben entstellten sein Gesicht. Er war von eigenartigem Körperbau, mit Armen, die bis zu den Knien reichten, und spindeldürren Beinen, und er schien sich stets nur rennend fortzubewegen. Hat man etwa ein dondimTier jemals gehen sehen?
Kho auf Tigerjagd zu sehen, überraschte viele Leute. Noch größer war ihre Verwunderung, als sie erfuhren, daß er den Tiger nicht jagte, um das Herz für sich als Talisman zu erringen, sondern weil er es als Medizin für Puas Heilung haben wollte. Nacht für Nacht konnte man Kho bei den Pfählen unter Puas Haus stehen und hinaufschauen sehen wie ein Liebeskranker oder ein Dieb.
Die Dorfbewohner von Hua Tat wußten nicht, auf welchen Pfaden Kho den Tiger aufzuspüren suchte. Die Wege eines dondimTieres kennt nicht einmal ein Tiger. Aber der Tiger spürte die Gefahr. Er wechselte seinen Standort und strich andere Pfade entlang. Stunde um Stunde belauerten Kho und der Tiger einander …
Eines Nachts, als man in Puas Haus gerade Geschichten erzählend zusammensaß, ertönte plötzlich ein Schuß, laut wie Donnergrollen. Die Berge hallten wider vom verzweifelten Brüllen des Tigers.
"Der Tiger ist tot! Kho hat den Tiger totgeschossen!" Das ganze Dorf war aufgewühlt wie ein sturmgepeitschter Wald. Die Leute stießen Freudenrufe aus, viele vergossen Freudentränen. Die Männer des Dorfes machten sich mit Fackeln auf den Weg in den Wald, um nach Kho zu suchen.
Erst gegen Morgen fanden sie Kho und den toten Tiger. Beide waren hinuntergestürzt in die allertiefste Schlucht. Khos Rückgrat war zerschmettert, sein Gesicht war von den Tigerkrallen zerkratzt. Der Schuß hatte den Kopf des Tigers aufgerissen. Die Kugel war, die Stirn zerfetzend, tief ins Gehirn gedrungen.
Aber das Befremdlichste war, daß die Brust des Tigers aufgeschnitten und das Herz verschwunden war. Der Schnitt war noch frisch, das Blut trat Schaumblasen bildend aus der Wunde. Jemand hatte das das Tigerherz gestohlen!
Die Männer aus Hua Tat schwiegen still und ließen den Kopf hängen, voller Scham und brennendem Zorn.
Sehr viele Menschen waren während des Winters durch den Tiger umgekommen. Zwei weitere starben danach: Kho und Pua …
Die Leute von Hua Tat vergruben den Tiger direkt dort, wo er gestorben war. Niemand erzählte mehr den Mythos von der Zauberkraft eines Tigerherzens. Die Menschen vergaßen die Geschichte wie man alle bitteren und unerträglichen Dinge vergißt, die auf dieser Welt geschehen. Das muß so sein.
Von denen, die diese Geschichte kannten, sind heute vermutlich nur noch sehr wenige am Leben..

Die zweite Geschichte:
In jenen Tagen lebten Fremde in Hua Tat; niemand wußte, aus welchem muong sie stammten. Sie bauten ein Haus am Dorfrand, in der Nähe des verwunschenen Waldes. Nur zwei betagte Leute, ein Mann und seine Frau, lebten in diesem Haus. Gingen sie aus, so gingen sie stets zu zweit. Die Frau war immer düster und stumm, oft hörte man von ihr den ganzen Tag keinen einzigen Ton. Der hochgewachsene, magere Mann hatte ein starres Gesicht, seine Nase glich einem Vogelschnabel. Die verschattet und tief liegenden Augen des Alten schienen dunkles kaltes Phosphorlicht abzustrahlen.
Der Mann war ein hervorragender Jäger. In seiner Hand schien das Gewehr Augen zu haben: Kaum ein Schuß, der nicht einen Vogel oder ein anderes Tier des Waldes getroffen hätte. Haufenweise lagen Vogelfedern und Tierknochen hinter seinem Haus. Die Vogelfedern waren mattschwarz wie Tusche; die kalksteinweißen Knochenhaufen durchzog stinkende hellgelbe Knochenmarksflüssigkeit. Diese Haufen waren so groß wie Gräber. Für den Wald war der Jäger die Verkörperung des Todes. Die Vögel und die Waldtiere fürchteten ihn. Die Jäger aus Hua Tat beneideten ihn, gleichzeitig waren sie unzufrieden mit ihm. Der Alte ließ kein einziges Tier, das ihm vor die Flinte kam, entkommen. Jemand berichtete, er habe mit eigenen Augen gesehen, wie der Alte einen tanzenden Pfau totgeschossen habe. Ein tanzender Pfau: den Kopf wie einen Reishalm gebeugt, den Schwanz zum farbenprächtigen Rad geschlagen, das die schimmernden Sonnenstrahlen in funkelndem Feuerschein aufblitzen läßt wie Gold, setzt er die Stelzenbeine gewandt im Kreis. Nur die Liebe kann solch einen kunstvollen Tanz hervorbringen. Und als der Pfau gerade so tanzte, da bumm! riß es die Flinte in der Hand des Alten hoch, und sie stieß eine rote Feuerzunge aus. Der Pfau fiel, seine regenbogenfarbenen Schwingen blutbefleckt. Die hagere, finstere, verschlossene Frau des Alten hob den Pfau auf und steckte ihn in ihren lep13.
Obwohl er sein ganzes Leben der Jagd widmete, schoß der Alte nur Vögel und Kleintiere, nie erlegte er ein großes Tier mit drei oder vier Zentnern Fleisch. Sein Gewehr konnte nur kleine dumme Tiere erschießen. Dies wurmte und quälte den Alten sehr.
Die Dorfleute von Hua Tat mieden den Alten und seine Frau, niemand sprach oder verbrachte seine Zeit mit ihnen. Wer sie sah, wandte sich ab und wich aus. Und so führte der alte Jäger ein einsames Leben an der Seite seiner trübsinnigen Frau.
Am Ende des Jahres war der Wald von Hua Tat wie leergefegt: Die Pflanzen kümmerten, die Vögel waren spurlos verschwunden, im ganzen Wald fand sich keine einzige Fährte irgendeines Tieres. So etwas hatten die Leute von Hua Tat noch nie zuvor erlebt. Man sprach von einer Strafe des Then14. Auch der fremde alte Jäger hatte Schwierigkeiten, etwas zu essen zu finden. Mit seiner Frau durchstreifte er jeden Winkel des Waldes. Das erste Mal in seinem Leben befand er sich in einer solch schwierigen Lage. Drei Mondphasen lang fiel aus seiner Flinte kein Schuß. Jeden Morgen schulterte er mit dem ersten Hahnenschrei sein Gewehr und ging bis in die Nacht hinein auf Jagd. Seine Frau fand nicht mehr genug Kraft, ihn zu begleiten. Sie hütete zu Hause das Feuer und wartete. Die Flammen schienen verhext, sie brannten nicht rot, sondern grellgrün wie die Augen eines Wolfs.
Einmal blieb der Alte eine ganze Woche lang weg. Er war erschöpft. Seine Knie knickten ein, alle Muskeln waren schlaff und kraftlos, so daß sie sich unter dem Händedruck anfühlten wie weiche Blutegel. Er hatte sich überall hingeschleppt, aber nichts gefunden, auch keine Grasmücke, ja nicht einmal einen Falter. Unschlüssig zauderte er, voller Angst. Strafte Then die Erde, wie die Leute sagten?
Schließlich mußte er sich, erschöpft und völlig ausgepumpt, mühsam nach Hause schleppen. Am Dorfrand angekommen, blieb er stehen und schaute auf sein Haus. Ein Feuerschein war zu sehen, eine grüne Flamme, sicher war seine Frau noch auf und wartete auf ihn. Er kniff seine verschatteten, tiefliegenden Augen fest zusammen. Nach einem Moment des Nachdenkens wandte er sich erneut dem Wald zu. Seine Nase witterte ein Tier … So ein Glück! Er sah es. Ein tanzender Pfau. Wie seine Beine sich zierlich nach rechts bewegten, sein aufgefächertes Rad sich nach links schob, ein grünes Licht aus dem prächtigen Federbusch auf seinem Kopf erglühte! Der Alte hob die Flinte: "Peng!" Er hatte getroffen. Ein durchdringender, absterbender Schrei. Er rannte hin zu dem Tier, das er erschossen hatte. Es war seine Frau. Sie war in den Wald gegangen, um dort auf ihn zu warten. In der Hand hielt sie noch die Pfauenfedern.
Der alte Jäger sank zur Erde nieder, warf sich mit dem Gesicht in die Blutlache auf den modrigen, muffigen Blätter, die nach Ratten rochen.
Aus seinem Mund kam ein Grunzen wie von einem wilden Eber. Sehr lange lag er so da. Eine schwarze Wolke senkte sich feucht herab, der Wald wurde pechschwarz, er war sehr heiß, wie die Haut eines Fiebernden. Gegen Morgen sprang der Alte plötzlich auf, schnell wie ein Eichhörnchen. Er hatte beschlossen, den Leichnam seiner Frau als Köder für ein Tier, das größte Tier seines Lebens, zu benutzen. Er legte sich zwei Armeslängen entfernt von der verwesenden Leiche ins Gebüsch, die Kugel im Lauf, gespannt wartend. Aber Then strafte den Alten. Kein Tier kam in seine Nähe, dafür aber der Tod.
Drei Tage später zog man den zusammengekrümmten Leichnam des Alten aus dem Dickicht. In seiner Stirn steckte eine Kugel. Er hatte das größte Tier seines Lebens erlegt.
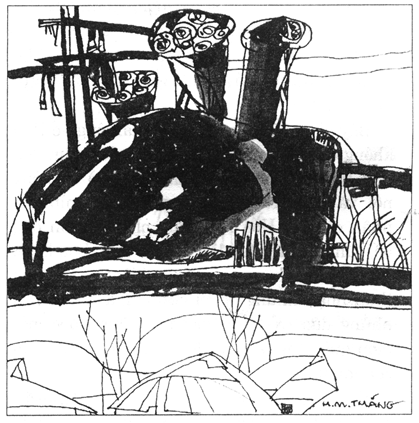
Die dritte Geschichte:
In Hua Tat lebte eine Frau namens Lo Thi Bua. Sie war anders als die anderen. Niemand grüßte sie auf der Straße. "Sie ist eine Hexe! Komm ihr nicht zu nahe!", warnten die Eltern ihre Kinder und die Frauen ihre Männer.
Bua war eine anziehende junge Frau. Sie war hochgewachsen, hatte starke, gesunde Hüften, einen kräftigen, muskulösen Körper, weiche, volle Brüste. Sie war immer heiter, sie schien ein Licht auszustrahlen, das die Herzen der Menschen zu ihr hin zog.
Bua lebte allein mit ihren neun Kindern. Niemand wußte, wer ihr Vater war. Nicht einmal Bua selbst vermochte genau den Vater jedes einzelnen Kindes zu nennen. Sehr viele Männer waren zu ihr gekommen und hatten sie dann verlassen. Junge Burschen, deren Atem noch nach Milch roch und die noch viel zu unerfahren für eine Vaterschaft waren, ältere, erfahrene Männer, mutige Jäger, geizige Kerle … Jeder von ihnen kam auf seine eigene Weise zu Bua, und jeder verließ sie anders als die anderen. In Liebesdingen verhält sich das männliche Geschlecht für gewöhnlich rational und ohne Pflichtgefühl, das weibliche Geschlecht vertrauensselig und hingebungsvoll bis zur Selbstaufgabe. Bua empfing alle Männer, die zu ihr kamen, gleichermaßen feurig und zeigte sich gleichermaßen gleichgültig gegenüber denjenigen, die sie verließen. Sie zog die vaterlosen Kinder, die sie gebar, alleine auf. Mit keinem Mann im Dorf war sie fest verbunden. Vor aller Augen lebte sie allein und unbeeindruckt. Niemand konnte ahnen, ob sie irgend etwas auf die öffentliche Meinung gab.
Die vielköpfige Familie lebte einhellig und mittellos zusammen. Die Frauen im Dorf waren wütend, sie zischten verächtliche Worte durch die Zähne. In Wirklichkeit fürchteten sie sich. Die Männer im Dorf spotteten lüstern. Dichtgedrängt saßen mit fiebrig glänzenden Augen geifernd am Feuer.
In Hua Tat hatte jeder eine ordentliche eigene Familie. Jeder mußte in Einklang mit der Überlieferung leben, die Frauen mußten Männer haben, die Kinder einen Vater. So eine unvorstellbare Familie hatte es doch noch nie gegeben!? Die Frau ohne Mann! Die Kinder ohne Vater! Neun Kinder! Neun Kinder, und keines glich dem anderen! Wie eine Epidemie zogen Spott und Hohn durchs Dorf, befielen die Frauen wie eine Läuseplage, die Männer wie Fieber … Am heftigsten betroffen waren die Frauen. Sie drängten die Männer, eine Lösung zu finden und diesen Zustand zu beenden: Entweder müsse man Bua aus dem Dorf jagen oder die Väter dieser Kinder ausfindig machen. Wie könnte man eine solche Familie weiterhin in der Dorfgemeinschaft dulden? Diese Kinder würden heranwachsen und männliche beziehungsweise weibliche Gemeindemitglieder werden. Und dann würden sie jegliche Tradition zerstören.
Ein Treffen der Männer von Hua Tat wurde mehrmals vereinbart, fand aber nie statt. Viele Männer trugen mit Schuld an diesem Problem. Sie hatten ein schlechtes Gewissen. Hervorzutreten und sein Kind anzuerkennen, wagte keiner. Sie fürchteten die Zungen ihrer gutgläubigen, treuen Frauen. Sie fürchteten die öffentliche Meinung. Und vor allem fürchteten sie ein Leben in Armut. In jenem Jahr wuchsen im Wald von Hua Tat zahllose mai-Knollen15. Ohne Anstrengung konnte man riesige Knollen ausgraben. Sie waren bröckelig, dufteten frisch und reichhaltig. Auf kleiner Flamme geschmort, zerfielen sie; es war wundervoll, sie so heiß zu essen, daß sie den Gaumen verbrannten. Auch Bua und ihre Kinderschar zogen hinaus, um die Knollen auszugraben. Der Wald war duldsam und freigebig gegenüber jedermann.
Eines Tages, als sie wieder nach Knollen stocherten, stießen Bua und ihre Kinderschar auf einen schartigen Tonkrug, die Glasur stumpf wie die Haut eines uralten Aals. Bua wischte die Erde um die Öffnung des Kruges weg und sah mit Erstaunen, daß der Krug gefüllt war mit funkelnden Gold und Silberbarren. Sie wurde schwach, zitterte am ganzen Körper, fiel auf die Knie, das Gesicht mit Freudentränen überströmt. Alle ihre Kinder strömten herbei und umringten ängstlich starrend ihre Mutter.
Im Handumdrehen war aus einer armen und geringgeschätzten Frau die reichste des Dorfes, ja des ganzen muong geworden.
Jetzt brauchten die Männer des Dorfes keine Versammlung wegen Bua mehr abzuhalten. Einer nach dem anderen kam zu Buas Haus, um sein Kind anzuerkennen. All die gutgläubigen und treuen Frauen drängten ihre Männer, hinzugehen und sich zu einem Kind zu bekennen. Es stellte sich heraus, daß es nicht nur neun Väter gab, auch nicht nur zwanzig; ihre Zahl stieg sogar auf fünfzig. Bua erkannte jedoch keinen von ihnen als Vater eines ihrer Kinder an. Aber wer auch kam, erhielt ein Geschenk, um seine rechtmäßige Frau zufrieden zu stellen.
Am Ende des Jahres heiratete Bua einen Jäger, einen gutherzigen, kinderlosen Witwer. Vielleicht war es diesmal Liebe, denn in ihrer Hochzeitsnacht vergoß sie viele Tränen vor lauter Glück. Mit den früheren Männern hatte sie nie geweint.
Dann sollte Bua zusammen mit ihrem Mann noch ein Kind bekommen, ihr zehntes Kind, aber diese Frau war nicht in der Lage, ein Kind auf angemessene und der Tradition entsprechende Weise zu gebären. Sie starb mitten während der Geburtswehen unter einem Berg warmer Decken.
An ihrem Begräbnis nahm die ganze Gemeinde von Hua Tat teil. Alle Männer, alle Frauen, alle Kinder. Sie hatten ihr vergeben, und vielleicht hatte auch sie ihnen vergeben.

Die vierte Geschichte:
Ha Thi E war die Tochter des Dorfvorstehers Ha Van No. Nie hatte es ein schöneres Mädchen gegeben als E. Ihre Taille glich der einer GoldAmeise, ihre Augen strahlten wie die Sterne Khun Lu und Nang Ua16, ihre Stimme war weich und wohlklingend. Wenn sie lachte, lachte sie hell und klar und unbeschwert. Ihre Schönheit war unübersehbar, aber auch in ihrer Tugendhaftigkeit wurde sie von kaum jemandem übertroffen. Sie war der Stolz der Dorfleute von Hua Tat. Alle hofften, daß sie einen Mann finden möge, der ihrer würdig sei. Auch der Dorfvorsteher Ha Van No wünschte dies, und mit ihm die Dorfältesten. Ein so anmutiges und schönes Mädchen wie E einem Unwürdigen anzuvertrauen wäre ein Vergehen gegen Then, denn sie war doch Thens Geschenk an die Menschen von Hua Tat.
Wer kam in Frage? Das ganze Dorf diskutierte. Sehr viele wollten gerne der Schwiegersohn des Dorfvorstehers Ha Van No werden, junge Männer aus Hua Tat und auch von außerhalb. Die Dorfältesten blieben eine ganze Nacht auf, tranken gemeinsam mit Trinkröhrchen fünf Krüge Reiswein und beschlossen dann, eine Prüfung abzuhalten, um denjenigen als Mann für E auszuwählen, der die wertvollste aber gleichzeitig seltenste zu Tugend aufweisen würde. Welche Tugend würde das sein, die am wertvollsten und gleichzeitig am seltensten zu finden war? Wer würde diese Tugend besitzen? Alle jungen Männer hockten diskutierend um die Küchenfeuer ? wer weiß, wieviel Alkohol und Fleisch dabei vertilgt wurden. Offenbar können die jungen Leute heutzutage bei blankem Wasser nicht nachdenken ...
Einige Tage darauf trat ein unerschrockener junger Mann vor den Dorfvorsteher und die Dorfältesten: "Mut ist die wertvollste und gleichzeitig seltenste Tugend. Ich bin derjenige, der diese Tugend besitzt!" "Beweise es uns!", antwortete der Dorfvorsteher.
Der Junge Mann ging in den Wald. Am Nachmittag kehrte er zurück, auf der Schulter ein erlegtes Wildschwein. Das Wildschwein wog mehr als einen Doppelzentner, seine harten Borsten glichen IgelStacheln, und noch im Tod waren seine tückischen Augen blutunterlaufen. Der Junge Mann ließ das Wildschwein zu Boden fallen, seine Augen blitzen hell, sein Körper schien von einer strahlenden Aureole umgeben. Alle priesen ihn.
Der Dorfvorsteher sagte zu seiner Tochter: "Du siehst, der Junge ist wirklich mutig. Er hat seinen Mut bewiesen!"
E lächelte, ihr Herz klopfte heftig, wenn sie in die tapferen Augen ihres Bewerbers blickte. In diesen Augen brannte ein Feuer. Aber E, von natürlicher Klugheit, wußte, daß mutige Menschen sich oft hinreißen lassen von ihrer eigenen Vollkommenheit.
Sie antwortete: "Richtig, verehrter Vater! Der Junge hat uns seinen Mut bewiesen … das ist wirklich eine sehr wertvolle Tugend … Aber, verehrter Vater, Mut ist sicherlich eine sehr wertvolle aber keineswegs eine besonders seltene Tugend, denn der junge Mann brauchte lediglich vom Morgen bis zum Nachmittag, um ihn uns zu beweisen."
Alle Dorfältesten nickten mit dem Kopf. Es Worte fanden ihre Zustimmung. Das Wildschwein wurde zerteilt. Die ganze Nacht durch tanzten die Dorfleute den xoe17, um den Mut zu feiern, die Tugend, die zwar wertvoll, aber nicht selten ist. Tatsächlich besitzen viele junge Männer des Waldes diese Tugend ...
Einige Zeit darauf trat ein klug und gescheit aussehender junger Mann vor den Dorfvorsteher und die Dorfältesten: "Klugheit ist die wertvollste und gleichzeitig seltenste Tugend. Ich bin derjenige, der diese Tugend besitzt!" "Beweise es uns!", antwortete der Dorfvorsteher.
Der junge Mann ging in den Wald. Am Nachmittag kehrte er mit einem Paar Ottern zurück, beide unverletzt. Ottern sind die klügsten Tiere des Waldes, sie sind außerordentlich sensibel und flink, sie zu fangen erfordert nahezu übermenschliche Fähigkeiten. Der Junge Mann lächelte. Seine Augen blitzten hell, sein Körper schien von einer strahlenden Aureole umgeben. Alle priesen ihn.
Der Dorfvorsteher sagte zu seiner Tochter: "Du siehst, der Junge ist wirklich klug. Er hat seine Klugheit bewiesen!"
E lächelte, wieder klopfte ihr Herz heftig. In den Augen ihres Bewerbers brannte ein Feuer, tobte ein Sturm. Aber kluge Menschen werden immer sich immer grämen, vielleicht ein unglückliches Schicksal erleiden. Sie wissen zu viel …
Sie antwortete: "Verehrter Vater, Der Junge hat uns seine Klugheit bewiesen. Aber, verehrter Vater, Tugend ist sicherlich ein sehr wertvoll, aber keineswegs besonders selten, denn der junge Mann brauchte lediglich vom Morgen bis zum Nachmittag, um ihn uns zu beweisen."
Alle Dorfältesten nickten mit dem Kopf. Das Fleisch der beiden Otter wurde zubereitet. Die ganze Nacht durch tanzten die Dorfleute den xoe, um die Klugheit zu feiern, die Tugend, die zwar wertvoll, aber nicht selten ist. Tatsächlich besitzen viele junge Männer des Waldes diese Tugend ...
Einige Zeit darauf erschien ein beleibter Reiter vor dem Dorfvorsteher und den Dorfältesten: "Reichtum ist die wertvollste und gleichzeitig seltenste Tugend. Ich bin derjenige, der diese Tugend besitzt!" Mit diesen Worten warf der Dicke unzählige Gold und Silberstücke auf den Boden. Den Leuten gingen die Augen über. Der Dorfvorsteher und die Dorfältesten schwiegen stumm. Sie hatten noch niemals einen so unglaublich reichen Mann gesehen.
"Reichtum muß man nicht beweisen", sagte der Dicke.
Alle Dorfältesten nickten mit dem Kopf. Auch der Dorfvorsteher nickte mit dem Kopf. Der Dicke lächelte, in seinen Augen brannte ein Feuer, tobte ein Sturm, und sogar die Dunkelheit der Nacht war in ihnen zu sehen. Sein Körper schien von einer strahlenden Aureole umgeben.
Der Dorfälteste fragte E: "Nun, mein Kind … Ist Reichtum die wertvollste und gleichzeitig seltenste Tugend?"
"Er ist sicherlich sehr selten", antwortete E. Aber Reichtum ist nicht wertvoll. Verlogenheit zahlt sich aus … Man kann nicht reich sein, ohne zu lügen."
Die Dorfältesten brachen in Lachen aus. Wieder tanzte man die ganze Nacht durch den xoe, um den Reichen zu feiern.
Schließlich kam ein junger Mann aus Hua Tat, um sich dem Dorfvorsteher und den Dorfältesten vorzustellen: Es war Hac, ein Waise, der hervorragendste Jäger des Dorfes. Hac erklärte jedem: "Aufrichtigkeit ist die wertvollste und gleichzeitig seltenste Tugend. "Beweise es uns!", verlangten sie.
"Aufrichtigkeit ist nicht eine silberne Halskette, die für jeden sichtbar ist und und die jeder anfassen kann", antwortete Hac. Alle redeten erregt durcheinander, die Dorfältesten berieten sich. "Du mußt es beweisen!", schrie der Dorfvorsteher mit vor Zorn glutrotem Gesicht, als er sah, mit welch liebevollen Blick E Hac bedachte. "Wer glaubt Dir?! Wer sagt, daß dieser Junge wirklich aufrichtig ist?", fragte der Dorfvorsteher.
"Then weiß es!", antwortete Hac.
"Ich weiß es auch!", erklärte E feierlich.
"Das ist verrückt!", brüllte der Dorfvorsteher. Er schaute beistandsuchend zu den Dorfältesten hin. Er wußte, daß die Alten immer einen einfachen Ausweg aus allen Wirrungen des Lebens finden.
"Du mußt Then anflehen!", sagte ein Dorfältester zu Hac, "Zur Zeit herrscht Dürre. Alle mo18 sind völlig ausgetrocknet. Zum Beweis deiner Aufrichtigkeit bitte Then um Regen!"
Am Mittag des darauffolgenden Tages errichteten die Dorfleute von Hua Tat einen Altar. Die Luft war erstickend schwül. Hac trat an den Altar, hob die Augen zum Himmel und sagte: "Ich führe ein Leben in Aufrichtigkeit, obwohl ich weiß, daß das immer mit Schmerzen und Bitterkeit verbunden ist. Aber wenn einem aufrichtigen Herzen vergeben wird und es die Liebe in die Welt tragen kann, dann möge der Himmel bitte regnen."
Der Himmel schwieg still. Plötzlich kam von irgendwoher ein leiser Hauch. Die Bauwipfel im Wald begannen zu säuseln. Kleine Staubwölkchen wurden vom Erdboden hochgewirbelt.
Am Nachmittag ballten sich dicke Regenwolken am Himmel zusammen, und mit Einbruch der Dunkelheit goß es in Strömen.
Dieses Mal tanzen die Leute den xoe eine ganze Mondphase lang, um die Hochzeit von Hac mit der Tochter des Dorfvorstehers zu feiern. Das war das fröhlichste xoeFest in Hua Tat. Alle waren betrunken. Jeder Hauspfosten, ja sogar jeder Baum im Garten war eingeladen, ein großes Trinkhorn Alkohol zu trinken.
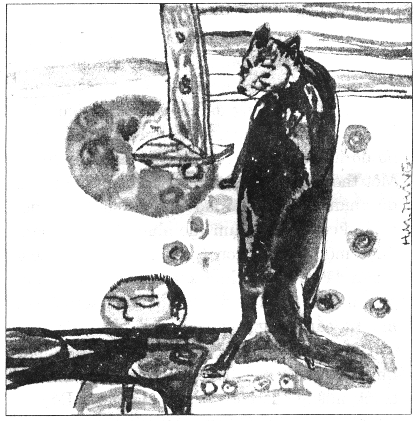
Die fünfte Geschichte:
In Hua Tat lebte eine Familie von Jägern namens Hoang, deren Generationen sich bis zu Lebzeiten von Hoang Van Nhan in allen Dörfern des muong19 hohes Ansehen erworben hatten. Nhan war ein ausgezeichneter Schütze und übernahm die Leitung einer jeden Jagdsaison. Er kannte keine Furcht. Darin glich er seinem Vater, seinem Großvater und seinem Urgroßvater.
Nhan hatte zwei Frauen, aber keine von beiden bekam ein Kind.
Als er schon jenseits der fünfzig war, heiratete er ein drittes Mal, und glücklicherweise gebar diese Frau ihm einen Sohn von überirdischer Schönheit. Nhan gab ihm den Namen Hoang Van San.
Ab seinem fünften Lebensjahr begleitete San seinen Vater in den Wald. Nhan war entschlossen, seinen Sohn ebenfalls zu einem geschickten Jäger heranzuziehen. Die Dorfältesten rieten ihm: "Warte, bis dein Sohn San dreizehn wird, das ist das richtige Alter dafür. Er muß lernen, den Wald zu fürchten, es ist nicht gut für ihn, zu früh dorthin zu gehen!" Nhan erwiderte: "Mein Vater hat mich auch schon als Fünfjährigen in den Wald mitgenommen!" "Das waren andere Zeiten", sagten die Dorfältesten, "dein Vater hatte vier Kinder, du aber hast nur eins...".
Nhan lachte spöttisch. Wir Jungen lachen oft genauso spöttisch über die Alten. Wir begreifen nicht, daß die Worte der Alten manchmal Prophezeiungen gleichen. Die Alten wissen Bescheid über die Furcht, und sie wissen, daß die Furcht kein Vergnügen ist.
San wuchs heran, im Alter von acht Jahren konnte er einen Fasan in der Schlinge fangen, als Zehnjähriger traf er von zehn Schüssen sieben Mal ins Ziel. Da fand Nhan, es sei an der Zeit, seinem Sohn die Jagd auf wilde Tiere beizubringen. Im Alter von zwölf Jahren nahm Nhan ihn mit auf die Wolfsjagd.
An jenem Tag zählte die Gruppe, die Nhan folgte, mehr als 30 Jäger. Der Wolf ist ein kluges und stolzes Tier des Waldes. Er ist grausam und hinterlistig. Werden Wölfe von Jägern angegriffen, zerstreuen sie sich und opfern notfalls einige Tiere als Köder, um den größeren Teil des Rudels zu retten. Nhan hatte große Erfahrung, er schickte einige Jäger den Ködern hinterher, während er selbst mit den anderen der Gruppe dafür sorgte, daß das Rudel nicht entkommen konnte. Er ließ sich von dem Leittier nicht überlisten. Das war eine alte Wölfin mit rötlichem Fell. In ihrem Lauf schmiegte sie sich an die Erde und jagte im gewundenen Zickzack davon. Nhan war entschlossen, ihr nachzusetzen, sie bis zu ihrer Höhle zu verfolgen.
San hielt sich dicht hinter seinem Vater. Er war schon mit dem durchdringenden Heulen der Wölfe vertraut. Nhan hatte ihn gelehrt, die unterschiedlichen Signale der Wölfe zu verstehen den Laut des Befehls, den der Aufforderung, den Angstschrei sowie die verschiedenen Arten, mit dem Schwanz zu wedeln, in ihrer Bedeutung auseinanderzuhalten. Als der Tag sich dem Ende zuneigte, hatten die Jäger das Wolfsrudel nahezu vernichtet.
Der Ring der Jäger zog sich um die Leitwölfin in ihrer Höhle zusammen, einer tiefen Höhle mit Säulen aus mit dunkelgrünem Moos bedeckten Steinen. Die Wölfin war alt, ihr Pelz zeigte auf dem Rücken schon mehrere graue Stellen. In ihrer Höhle umzingelt, wehrte sie sich verbissen, die Augen blutunterlaufen. Wer weiß, was dabei in ihrem Kopf vorging. Einen Augenblick lang starrte sie unverwandt Nhan an, als wolle sie sich seine Gestalt einprägen, dann stürzte sie in den hintersten Winkel der Höhle, wo der Wurf ihrer Jungen zusammen lag. Gerade als es ihr gelang, ein Junges zu packen, fiel ein Schuß. Nhan jagte eine ganze Salve in den Wolfsleib. Die Leitwölfin brach über dem winzigen Wolfsjungen zusammen, die Zähne in seinen Scheitel gebohrt. Die Jäger drangen in die Höhle vor, zerrten den Körper der Leitwölfin zur Seite und ergriffen die Jungen. San löste das Wölfchen aus den Zähnen seiner Mutter. Es war das schönste des Wurfs.
Der kleine Wolf wuchs unter den Haushunden heran. Sein Scheitel zeigte weiterhin die Spuren der Zähne: dort hatte sich eine Narbe gebildet, auf der kein Fell wachsen wollte. Der kleine Wolf wurde in Nhans Haus aufgezogen. Er gewöhnte sich an die Menschen und glich im Großen und Ganzen einem Haushund, abgesehen von seinen Augen und seinem Verhalten: Seine Augen waren bösartig, sein Verhalten verstohlen und hinterhältig. Weder Nhan noch San mochten ihn. Jedoch unternahm der Wolf nie etwas gegen den Willen der Menschen oder der Tiere im Haus. Er wich allen Zusammenstößen aus und zeigte ein so überaus sanftes Wesen, daß es ganz sonderbar war. Weder stritt er mit den Hunden um das Fressen, noch reizte er die Pferde, Ziegen, Schweine oder Hühner. Er verhielt sich still und sehr umsichtig. Er schien zu wissen, daß keiner im Haus ihn mochte.
Die Zeit eilte vorüber, und schon wurde San dreizehn. Nhan bereitete eine Feier für seinen Sohn vor. Zur Bewirtung der Dorfbewohner sollten zwei Schweine geschlachtet und bei dieser Gelegenheit auch gleich der Wolf getötet werden.
Als man an jenem Tag die Schlachtmesser wetzte, geschah ein schreckliches Unglück. San saß neben seinem Vater. In seine schönsten Leinensachen gekleidet, wirkte er wie ein würdiger Herr. Nhan forderte seinen Sohn auf, nachzusehen, wie weit die Vorbereitungen seien. San nickte und sprang in drei Sätzen die Treppe aus goldenem vang kiengHolz hinunter. Unglücklicherweise blieb er dabei aber mit einem Hosenbein hängen und stürzte zu Boden, genau dorthin, wo der Wolf angekettet war. Der Wolf, aus dem Halbschlaf gerissen, sprang auf. San schlug mit dem Kopf auf einem Stein neben dem Wolf auf, sein Mund stieß an die Eisenkette, mit der das Tier am Hals angekettet war. Blut strömte aus Sans Mund. Diese Blutspur aus dem Mund des Jungen weckte etwas aus dem tiefen Instinkt des wilden Tieres. Es sprang los, die spitzen Zähne gefletscht, und schlug sein weißes Gebiß in den Hals des Jungen, dort, wo seine Haut mehrere unregelmäßige dunkle Flecken aufwies. Die Leute im Haus liefen erschrocken herbei. Wie irrsinnig ließ der Wolf nicht ab von dem Jungen. Er biß, kratzte, zerrte, kaute, riß Fleisch, Fasern und blutverschmierte Sehnen in Fetzen aus Sans Hals. San war sofort tot, seine Augen brachen. Der Hals war ein einziges tiefes, hellrotes Loch, aus dem das Blut heraussprudelte, in großen Blasen herausschäumte. Das Blut spritzte dem Wolf ins Gesicht und färbte sein struppigzerzaustes KopfFell purpurrot.
Erst nach verzweifelter Anstrengung gelang es, das Tier wegzuzerren. Tränenüberströmt schritt Nhan auf den Wolf zu, die Axt in der Hand. Die Leute wichen zur Seite. Nhan zitterte am ganzen Leib. Der Wolf hatte sich tiefgeduckt unter die Treppe verkrochen. Einen Augenblick hielt Nhan inne, dann schwang er plötzlich die Axt und durchtrennte mit einem einzigen Hieb die eiserne Kette. Die Schneide der Axt verbog sich, als sie die Kette zerschmetterte. Der Wolf heulte auf, dann schoß er in Richtung Wald davon, am Hals baumelten noch einige Kettenglieder. Vor Schreck erstarrt, umringten die Leute Nhan. Der ließ die Axt sinken, kniete nieder beim Leichnam seines einzigen Kindes; seine mageren, knochigen, gelenksteifen Finger scharrten über die blutgetränkte Erde.
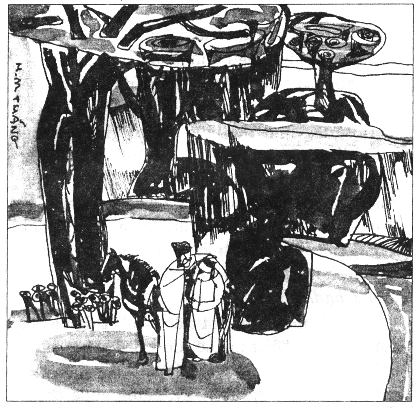
Die sechste Geschichte:
Der Alte Lo Van Panh war in Hua Tat wohlbekannt. Trotz seines hohen Alters von über 80 Jahren waren seine Zähne noch so regelmäßig wie die eines Siebzehnjährigen. Wenn er die Reiskörner zerstieß, betrieb er den Mühlstein wie im Spiel mit einer Hand. Er arbeitete für drei. In Bezug auf Alkohol verhielt es sich genauso: Mit seiner Trinkfestigkeit stach unzählige andere Männer aus. Er genoß die Hochschätzung der Heranwachsenden von Hua Tat.
Panh hatte drei Frauen, acht Kinder und um die dreißig Enkel. Sie lebten einmütig und im Wohlstand zusammen. Die Familie glich der Kohle im Ofen: die Kohlestückchen vermögen es, einander zu wärmen, um sich schließlich gegenseitig zu entflammen. So sind Familien eben.
Wäre Panh einfach weiterhin im Tal von Hua Tat geblieben, so wäre die ganze Geschichte nicht passiert. Aber eines Tages faßte er plötzlich den Entschluß, nach Muong Lum zu reisen, um dort Büffel zu kaufen. Eigentlich hätte der Alte Panh, wenn es nur um den Büffelkauf gegangen wäre, nicht einen solchen Aufwand treiben müssen, es hätte genügt, sich in die Dörfer Chi oder Mat zu begeben, um für die Feldarbeit bestens geeignete Büffel zu finden. Aber Muong Lum war der Ort, in dem Panh seine Jugend verbracht hatte. Längst vergangene Erinnerungen erwachten in ihm zu neuem Leben.
Muong Lum ist ein entlegener Ort im äußersten Zipfel von Chau Yen. In der Sprache der Thai bedeutet Muong Lum vergessenes Land. Dort erstrecken sich seit alters her Urwälder, ein endloses Pflanzenmeer mit zahllosen Tier und Vogelarten.
An jenem Tag war Panh zu Pferd bis in die Nähe von Muong Lum gekommen, als der Himmel sich verdunkelte und ein ungestümer Hagelschauer hereinbrach.
Auf der Suche nach einem Unterschlupf, der ihm Schutz gewähren würde, fand er in dem hügeligen Gelände weit und breit nichts als messerscharfes Gestrüpp. Der Hagel prasselte aus großer Höhe herab. Das kopfscheue Pferd ließ sich keinen Schritt mehr vorwärts bewegen, wiehernd stemmte es die Hufe in die Erde.
Fluchend sprang Panh herab, noch niemals zuvor hatte er einen solch rasenden Hagelsturm erlebt. Der Wind blies unglaublich heftig, die Hagelkörner peitschten schmerzhaft auf ihn nieder. Die Nacht brach herein, Donner und Blitz ließen die Erde erbeben, das Pferd riß sich los und jagte den Abhang hinab. Panh wollte schon hinterher, als er plötzlich eine kleine, schemenhafte Gestalt bemerkte, die sich auf ihn zu bewegte. Er blieb stehen. Es war ein Mädchen. Auf dem Heimweg von der Feldarbeit vom Unwetter überrascht, war sie, zutiefst erschrocken, stolpernd und unaufhörlich den Himmel anrufend davongestürzt. Bei Panh angekommen, warf sie sich völlig ausgepumpt in seine Arme. Es goß in Strömen, und die Hagelkörner prasselten herab wie Schrotkugeln. Panh beugte sich schützend über das Mädchen; die hatte ihr Gesicht in den Handflächen verborgen und zitterte am ganzen Leib. Vertrauensvoll lehnte sie sich an seine nackte starke Brust. Er sprach beruhigend auf sie ein: "Hab' keine Angst, hab' keine Angst … Thens20 Zornesausbruch wird vorübergehen …".
So standen sie inmitten der gestrüppbedeckten Hügel, umtobt vom lang anhaltenden Hagelgewitter. Wie von einem Schwindel wurde Panh von einem geheimnisvollen, unfaßbaren Gefühl gepackt. Noch nie in seinem ganzen erfahrungsreichen Leben hatte er so etwas empfunden. Er wußte, das war genau das, wonach er sich die ganze Zeit gesehnt, was er immer zu finden gewünscht hatte. Das war mehr als Liebe, mehr als alle Empfindungen den Frauen gegenüber, mit denen er bisher zusammengetroffen war dieses Gefühl war das Glück selbst.
Als das Unwetter sich legte, überzog den Himmel ein feurig schimmernder Schein. Das Mädchen löste verlegen ihre Hände aus den seinen. Nie hatte Panh eine solche Schönheit gesehen. Sie rannte weg. Bestürzt setzte Panh ihr nach, strauchelte, aber es gelang ihm letztendlich, sie am Arm zu packen.
"Wie heißt du?", fragte er. "Morgen werde ich kommen und einen Heiratsantrag machen, einverstanden?"
Verwirrt stammelte sie nach einer Weile zögernd: "Ich bin Muon … aus dem Dorf Muong Lum …".
Sie wand sich aus seinem Griff und rannte den Hügel hinunter, ihre nackten Waden blitzten zart und weiß. Der Alte Panh sank auf die Erde nieder, der Schweiß brach ihm aus, er war erschöpft. Ein Gefühl großer Wonne durchströmte sein Herz. Er lag auf dem Boden inmitten des tropfnassen Gestrüpps, ohne die schwarzen Riesenameisen zu bemerken, die auf seiner nackten Brust durcheinander krochen. So blieb er liegen, bis ihn sein kluges Pferd fand und mit seinem warmen Maul an seinen großen Ohren knabberte, aus denen einige schwarzgelockte Haarbüschel hervorstanden.
Am Mittag des folgenden Tages lenkte der Alte Panh sein Pferd ins Dorf und zu Muons Haus. Er kniete nieder, stapelte den ganzen Haufen der für den Büffelkauf bestimmten Silbermünzen vor Muons Vater auf. Als der den Antrag seines Gastes vernahm, lachte er auf und rief Frau und Kinder sowie die Dorfbewohner herbei. Alle schwatzten und scherzten. Panh blieb unter den spöttischen Worten, die ihn spitz und scharf wie Messer trafen, standhaft. Muon schaute hinter dem Türspalt versteckt hervor. Sie fühlte sich gut, und fand die ganze Geschichte komisch. Den Hagelsturm der vergangenen Nacht, die Tränen und die Begegnung auf dem Hügel hatte sie ganz und gar vergessen.
Panh, hartnäckig und entschlossen, wiederholte seinen Heiratsantrag. Tatsächlich verhielt er sich dabei so würdig, daß keiner mehr über ihn lachen konnte. Schließlich mußte Muons Vater notgedrungen seine Bedingungen stellen: "Also gut, wenn du mein Schwiegersohn werden willst, mußt du uns beweisen, daß du den größten EisenholzBaum auf dem Gipfel des Phu Luong fällen und hierher bringen kannst. Aus diesem Holz entsteht dann das Haus für dich und meine Tochter Muon."
Wieder brachen alle in Gelächter aus. Keiner hier, der nicht diesen EisenholzBaum kannte, dessen Stamm acht Leute mit ausgestreckten Armen nicht umfassen konnten. Er wuchs auf dem Gipfel eines KalksteinFelsens, der so hoch war, daß, wenn man von dort oben herabschaute, das Dorf Muong Lum so klein wirkte wie das Dach eines einzigen Pfahlhauses.
"In Ordnung! Ich nehme dich bei deinem Wort!", antwortete Panh wie aus der Pistole geschossen21.
Panh hat, so heißt es, am darauffolgenden Tag den Gipfel erstiegen. Einen Axthieb führte er gegen den Stamm des EisenholzBaumes, dann verließen ihn die Kräfte. Er starb an gebrochenem Herzen.
An Panhs Beerdigung nahm Muon nicht teil. Sie ging an diesem Tag zum Markt nach Yen Chau und sah den Hahnenkämpfen zu. Abends auf dem Heimweg geriet sie wieder in einen Regenguß, aber dieses Mal fiel kein Hagel.

Die siebente Geschichte:
Seit Urzeiten befand sich auf dem Dachboden im Haus des
Dorfvorstehers Ha Van No ein Jagdhorn. Das Büffelhorn mit Silbereinlagen war
von Rissen durchzogen und voller Spinnweben; Wespen hatten sich darin
eingenistet. Niemanden kümmerte es. Das Jagdhorn lag dort unbeachtet herum und
verlotterte.
Eines Jahres tauchten im Wald von Hua Tat eigentümliche
schwarze Raupen auf. Winzig klein, klebten sie über und über auf jedem Zweig,
jedem Blatt. Ging man in den Wald oder auf das Feld in den Bergen, war das
Rascheln der Raupen, das Nagen an den Blättern unüberhörbar, und es lief einem
kalt den Rücken hinunter vor Ekel und Furcht. Es gab keinen Baum, keinen
Strauch, dessen Blätter diese Raupen nicht fraßen. Von den Reispflanzen bis zum
Bambus, Rattan, sogar dornenstarrende Gewächse, alles verschlangen sie gierig.
Der Dorfvorsteher Ha Van No magerte ab. Er suchte mit
den Dorfbewohnern nach irgendeinem Mittel, um diese widernatürliche Art von
Insekten zu vernichten. Sie schüttelten sie von den Bäumen, entzündeten Feuer,
um sie auszuräuchern, übergossen sie mit kochendem Wasser und giftigem Pflanzensaft22. Alle diese Mittel erwiesen sich als wirkungslos. Die Raupen vermehrten sich mit
unbegreiflicher Geschwindigkeit.
Das Dorf wirkte trostlos, wie von der Pest befallen.
Man erwog, Hua Tat zu verlassen und sich an einem anderen Ort anzusiedeln. Die
Dorfältesten versammelten sich zur Beratung. Voller Furcht bat man den
Schamanen um eine Opferzeremonie.
Der Dorfvorsteher Ha Van No wies die Leute an, Büffel und
Schweine zu schlachten, um Himmel und Erde und die Geister und Dämonen um
Schutz und Unterstützung zu bitten. Der Schamane sprach: „Die Gebeine der Ahnen
der Familie Ha vermodern und verwandeln sich in Raupen; man muß die Knochen
hervorholen an das Licht der Sonne und sie säubern, erst dann wird die Raupenplage
enden.“
Erschrocken zuckte der Dorfvorsteher zusammen. In
seiner Familie war es Brauch, die Verstorbenen zu verbrennen. Dann wurden die
Knochen in eine Urne aus glasiertem Ton gelegt und weggebracht. Nur ein
einziger Mann in der ganzen Sippe kannte das Versteck. Erst vor dem Tod wählte
er unter den Familienmitgliedern seinen Nachfolger aus. Gemäß einer allgemein
verbreiteten Überlieferung brauchte ein haßerfüllter Widersacher nur diese
Knochen zu finden, mit Schießpulver zu versetzen und abzufeuern, um die ganze
Sippe völlig zu vernichten. Die Familie Ha hatte nicht wenige Widersacher. Und
wenn nun die Knochen zum Reinigen hervorgeholt würden, wäre das Versteck aufgedeckt
- eine günstige Gelegenheit für die Feinde.
Der Dorfvorsteher versank ins Grübeln. Er wußte, daß
die Gegner jeden seiner Schritte ausspähten, aber konnte man denn dem Unheil
seinen Lauf lassen und zusehen, wie die Raupen die Heimat zugrunde richteten?
Eines Nachts am Ende des Monats stand der Dorfvorsteher
auf und wies seinen Sohn Ha Van Mao an, ihm zu folgen. Der 18jährige Mao war
talentiert, gescheit, geistig anderen überlegen.
Die beiden stahlen sich heimlich fort. Die Gebeine der
Familie Ha waren oben am Gipfel eines Berges in einer sehr tiefen Höhle
versteckt. Den Eingang zur Höhle verbargen die herunterhängenden Wurzeln eines
alten Feigenbaumes. Man mußte erst einen Durchschlupf durch das
dichtverschlungene Wurzelgeflecht schlagen, bevor man in die Höhle
hineinkriechen konnte. Das war sehr mühselig, und erst nach Sonnenaufgang
konnten die beiden die tönerne Urne aus der Höhle heraustragen.
Der Dorfvorsteher öffnete den Deckel und legte die
Knochen auf die Erde, um sie mit Alkohol zu waschen. Entgegen der Behauptung
des Schamanen waren die Gebeine unbeschädigt und keineswegs vermodert. Mitten
unter den Knochen lag eine außergewöhnlich kunstfertig gearbeitete Kordel aus
Silber. Mao fragte seinen Vater: „Wozu dient denn diese Schnur da? “ „Ich weiß
es nicht!“, antwortete der Dorfvorsteher, „Vielleicht, um irgendwelche
Werkzeuge oder Waffen festzubinden oder zu tragen?“ „Sie gefällt mir!“, sagte
Mao und steckte die Silberschnur ein.
Die beiden verließen die Höhle und begannen, den Berg
hinunterzusteigen. Als sie unweit der Höhle an eine Wegbiegung gelangten,
entdeckten sie einen Trupp fremder Personen im Hinterhalt liegen. Der
Dorfvorsteher sah in ihnen sofort Feinde. Er trug seinem Sohn auf, ins Dorf zu
eilen und Hilfe zu holen, während er dableiben und sich ihnen in den Weg stellen
würde.
Der Dorfvorsteher griff zu einer List. Er versuchte,
seine Feinde weit von der geheimen Höhle wegzulocken. So eindeutig unterlegen,
hing sein Leben an einem Haar.
Im Dorf angelangt, rief Mao unverzüglich die besten
Schützen herbei, um seinem Vater im Wald zur Hilfe zu eilen. Vereinzelte
Schüsse, die man aus dem Wald hörte, brannten wie Feuer in seinem Herzen.
Erst gegen Mittag fanden sie den Dorfvorsteher. Er war
ein Dutzend Meilen entfernt von der geheimen Höhle an einen Baumstamm
gefesselt. Sein leergeschossenes Gewehr lag zu seinen Füßen hingeworfen. Die
Feinde hatten ihm, als er sich weigerte, das Versteck der Gebeine seiner Sippe
zu verraten, die Zunge abgeschnitten. Mao half seinem Vater zurück ins Dorf.
Der Dorfvorsteher überlebte, war aber seither stumm, konnte nicht mehr sprechen.
Die verheerende Raupenplage breitete sich Tag für Tag
immer noch schrecklicher aus. Voll zorniger Empörung befahl Mao als Rache für
seinen Vater dem Schamanen die Zunge abzuschneiden. Dann wies er alle an, sich
bereit zu machen, das Dorf aufzugeben und sich anderswo anzusiedeln.
An dem Tag, an dem er die Haushaltsgegenstände
wegschaffen wollte, entdeckte Mao auf dem Dachboden das Horn. Es hatte eine
kleine Öse, an der man eine Schnur befestigen konnte. Da erinnerte der Junge
sich plötzlich an die Silberschnur, die er unter den Gebeinen seiner Vorfahren gefunden
hatte. Sogleich steckte er die Silberschnur durch die Öse. Da schien das alte
Horn auf einmal sehr viel schöner zu werden. Mao erhob das Horn und probierte
es aus. Und siehe da! Kaum erklang der erste Ton, als unverhofft die schwarzen
Raupen in den Bäumen sich wanden und auf die Erde herab stürzten.
Überrascht blies Mao mehrere Male ins Horn. Die
schwarzen Raupen fielen zu Boden wie Regen. Glücklich beeilte sich der Junge,
sofort den Umzug zu stoppen.
Das ganze Dorf folgte Mao, Freudenrufe ausstoßend, in
den Wald. Den ganzen Tag lang ließ das Horn unvermindert seinen
außergewöhnlichen Schall ertönen. Die schwarzen Raupen prasselten herab, man
brauchte sie nur haufenweise totzuschlagen. So war binnen eines einzigen Tages
die verheerende Raupenplage vollständig beseitigt.
Seit Überwindung der Raupenplage wurde im Dorf Hua Tat
Tag für Tag mit dem ersten Morgenlicht das Horn geblasen. Die Stimme des alten
Horns mahnte jeden, der Ahnen zu gedenken, gab Kunde von einem ruhigen, von
Raupen unbeeinträchtigten Leben.
Stets trug der alte stumme Ha Van No das Horn an seiner
Seite. Es sah ganz gewöhnlich aus, kein bißchen anders als jedes xbeliebige
andere Horn. Es war genau so häßlich, und auch sein Klang war nicht lauter.

Die achte Geschichte:
Von klein auf war Sa wild und tollkühn. Nie hörte er auf, von einem wahrhaft außergewöhnlichen Leben zu träumen. Eigensinnig und starrköpfig setzte er sich über alle Ratschläge hinweg und handelte ausschließlich nach seinem Gutdünken. Saufen? Wer es schafft, in einem Zug zwanzig Trinkhörner Schnaps zu leeren, soll nur mit ihm um die Wette trinken! Damhirsche jagen? Wer einem Damhirsch länger als drei ganze Tage hinterherrennen kann, bis das Tier schließlich vor Erschöpfung zu Boden stürzt, der soll nur kommen und mit ihm in Wettstreit treten! Wer schlägt den con24 schneller und geschickter er als er? Wer entlockt der Flöte süßere Weisen? Und wer übertrifft seine Meisterschaft beim Erobern der Frauenherzen?
Einmal hatte man in Hua Tat gerade mühsam den Tagesfang an Fischen aus dem See hoch ins Boot gezogen. Man ging daran, den Fang aufzuteilen, als Sa das Boot im Wasser umstürzte. Ungeachtet der Flüche und Wehklagen erstickte er fast vor Lachen, sprang ungestüm in den silberweißen, in alle Richtungen schnellenden Fischschwarm hinein, den er gerade freigesetzt hatte.
Sa war so verrückt, daß er sich herausfordern ließ, ins Feuer zu springen. Ein Lob aus Kinder oder Frauenmund war ihm kostbarer als eine Unze Gold. Aber – und dies ist genauso schlimm wie jede andere AlltagsGepflogenheit – kein einziger Einwohner des Dorfes Hua Tat lobte ihn jemals. Niemand rief ihn bei seinem Namen. „Verrückter Kerl“, „Irrsinniger Typ“, „Tollwütiger“ nannten sie ihn. Er lebte unter den Menschen wie ein wildes Tier. Unter dieser Art von Leben litt Sa bitterlich. Er begann an seinem Verstand und seinen Fähigkeiten zu zweifeln. Im Festgetümmel lustig, schwieg er gleich danach wieder wie versteinert. Den ganzen Tag, den ganzen Monat lang saß er da und fabrizierte Spielsachen oder irgendwelche Werkzeuge und Waffen, aber kaum hatte er etwas fertiggestellt, warf er es weg. Niemand ließ sich darauf ein, Zutrauen in einen so unberechenbaren Menschen zu setzen oder ihn mit einer Aufgabe zu betrauen. Gräßliche Einsamkeit zerriß ihm das Herz. Lebensgier und ungestüme Träume entfremdeten ihn jeglicher alltäglichen Ordnung. Auf das Zureden eines Salzhändlers aus dem Flachland hin verließ Sa im Alter von 30 Jahren Hua Tat mit dem Vorsatz, anderswo ein außergewöhnliches Leben zu führen. Ohne Sa schien das Leben in Hua Tat langweiliger. Die Raufereien waren nicht mehr so verbissen wie vorher. Die Frauen begingen seltener Ehebruch. Es gab keine Feste mehr, bei denen man die ganze Nacht hindurch bis weit in den Morgen hinein den xoe25 tanzte. Es wurde weniger gelächelt. Sogar der Flügelschlag der Vögel am Himmel über Hua Tat wirkte matt und kraftlos. Die Menschen wurden griesgrämig, die Arbeit lastete drückender als früher auf ihren Schultern. Da begann man Sa zu vermissen und seinen Weggang zu bedauern. Gelegentlich erzählte der Salzhändler Dinge über Sa, die alle erstaunten. Man hörte, er unterstütze die Can Vuong-Bewegung26 irgendwo im Flachland. Einmal hieß es, er sei gerade als Gesandter in ein schrecklich weit entferntes Land geschickt worden. Dann wieder sagte man, er habe als Mitverschwörer gegen den Hof in die Verbannung gehen müssen. Die Frauen begannen, Sa ihren Männern gegenüber als Vorbild herauszustellen, an dem sie sich ein Beispiel nehmen sollten. Genauso beriefen sich die Bewohner von Hua Tat im Wettstreit mit anderen Dörfern um diese oder jene Frage auf Sas Namen. Man führte sogar Dorfereignisse auf, an denen Sa gar nicht beteiligt gewesen war. Seine Reputation wurde ihr ganzer Stolz. So verging Jahr um Jahr. Die Leute dachten, Sa sei wahrscheinlich an einem Ort fern der Heimat gestorben, da kehrte er eines Tages unvermutet zurück. Das war aber nicht mehr der junge und ausgelassene Sa. Dieser hier war ein gebrechlicher Greis mit wildem Aussehen; ein Bein hatte er verloren, seine altersschwachen Augen waren trieften und blickten starr. Fragen nach dem großartigen Leben, das er geführt habe, beantwortete Sa zurückhaltend. Die durch den Salzhändlers in Umlauf gebrachten Berichte entsprachen offenbar trotzdem bis zu einem gewissen Grad der Wahrheit. Die Dorfbewohner von Hua Tat errichteten für Sa ein Pfahlhaus. Er führte ein normales Leben wie alle anderen. Brachte jemand die alten Geschichten zur Sprache, antwortete Sa ausweichend. Sa heiratete. Den beiden Alten wurde ein Junge geboren. Sa lebte noch lange, er starb erst im Alter von 70 Jahren. Vor seinem Tod soll er gesagt haben: „Erst in meinem letzten Lebensabschnitt, als ich in Hua Tat ganz gewöhnlich, genauso wie alle anderen lebte, konnte ich wirklich ein wahrhaft außergewöhnliches Leben führen!“ Konnte das wahr sein? In Hua Tat gab es niemanden, der diese Äußerung in Frage stellte. Aber Sas Totenfeier zelebrierte man feierlich wie die einer hochstehenden Persönlichkeit.

Die neunte Geschichte:
In Hua Tat lebte ein Ehepaar, Lu und Henh. Die beiden mochten sich seit ihren Kindertagen. Als Erwachsene liebten sie einander, heirateten und bekamen Kinder. Sie lebten in engster Vertrautheit, kannten jede Geste, jede Stimmung, sogar jeden Gedanken des anderen. Niemals entfernten sie sich voneinander. Als die Choleraepidemie in Hua Tat ausbrach, waren sie schon seit fünfzig Jahren zusammen.
Die Choleraepidemie sprang an einem Tag mit extremer Witterung von Muong La und Mai Son aus nach Hua Tat über: Bei unerträglicher Hitze regnete es in Strömen. Von der Erdoberfläche stieg schwülheißer Wasserdampf in dichten Schwaden auf und ließ die Menschen im Schüttelfrost erzittern. Zuerst starben die Kinder, dann die Alten. Den Armen folgten die Reichen. Die Gutherzigen starben zuerst, dann waren die Schurken an der Reihe. Dreißig Menschen starben in Hua Tat im Verlauf eines halben Monats. Hastig hob man Gruben aus, streute Kalk über die Grabhügel. Nachts veranstaltete Gevatter Tod ein xoeFest unter der Scheibe des schmutzigroten Mondes. Die Einwohner von Hua Tat bekämpften die Choleraepidemie mit einer in starkem Alkohol angesetzten Mischung aus kleingestoßenem Ingwer, Knoblauch und Chili. Selbst Säuglingen schüttete man das Gebräu schüsselweise in den Mund. Sie jammerten laut, wenn es ihre Eingeweide schier zerfetzte. Aber das macht nichts, denn im Verlauf eines Lebens müssen immer wieder die Eingeweide um und umgekehrt werden27.) Als die Epidemie ausbrach, war Lu gerade weit weg von zu Hause. Sein Hang zum Müßiggang und seine leidenschaftliche Spiellust hatten ihm seit Kindesbeinen wer weiß wie viele Male in Schwierigkeiten gebracht, und dieses Mal kosteten sie ihn das Leben. Er befand sich in einer Gruppe von Spielern in Muong Lum, und war die ganze Zeit über völlig in das Glücksspiel vertieft. Zehn Tage lang verließ ihn das Glück keinen Augenblick, sogar wenn er pinkeln ging, gewann er noch. Die Mitspieler verdächtigten ihn ernsthaft der Zauberei. Schließlich machte Lu sich auf den Heimweg, die Taschen voller Silbermünzen, und ließ die Verlierer in bitterer Verzweiflung zurück. Unterwegs, auf dem Markt von Yen Chau, kaufte Lu ein Pferd, ohne den geringsten Versuch, den Preis herunterzuhandeln. Der völlig fassungslose vietnamesische Pferdehändler schlug sich trommelnd gegen die Brust. Voller Selbstmitleid ging er in die Kneipe und soff, bis er nahezu bewußtlos war und das durch den Pferdeverkauf erlöste Geld restlos ausgegeben hatte. Gemächlich und frohgemut ritt Lu auf dem Pferd heimwärts. Als er das Dorf erreichte, sah er sich verblüfft einem Zaun aus eingeschlagenen Pflöcken und Zweigen gegenüber. Weißliches Kalkpulver bedeckte alles. Auf der khau cut28 eines jeden Pfahlhauses drängten sich dicke fette Raben. Man hinderte Lu, das Dorf zu betreten, und wies ihm lediglich den Weg in den verwunschenen Wald, wo seine Kinder just an diesem Morgen ihre Mutter begraben hatten. Henh war tot; das frisch mit Kalk bestäubte Grab war ihres. Rasend vor Schmerz trieb Lu sein Pferd im Galopp zum Begräbnisplatz seiner Frau. Weinend und wehklagend fiel er vor dem Grab nieder. „O Henh“ schluchzte er, „wie soll ich weiterleben ohne dich? Wer wird, wenn ich von der Arbeit auf dem Feld in den Bergen heimkomme, Wasser heiß machen, damit ich mir das Gesicht waschen kann? Wer wird, wenn ich einen Hirsch geschossen habe, für mich ein lap-Gericht kochen? Mit wem soll ich meine Freude, meinen Kummer teilen?“ Lu weinte eine sehr lange Zeit. Seine erwachenden Erinnerungen bereiteten ihm zusätzlichen Schmerz. Er liebte Henh abgöttisch. Er erkannte, wie undankbar und lieblos er gewesen war, und wie edelmütig und duldsam seine Frau. Je mehr er nachdachte, desto reumütiger und trauriger wurde er. Auf wie viele Bissen Essen hatte Henh verzichtet, wie viele Stücke schönen Stoffs hatte sie aufgespart – alles für ihn, für die Kinder. Sie hatte mit ihm gelebt wie eine ältere Schwester, eine Mutter, eine Dienerin. Und was hatte er für sie getan, in mehr als fünfzig Jahren? Er neigte sein Haupt vor dem Grab, da vernahm er plötzlich ein Stöhnen aus dem Erdreich heraufdringen. Das war Henh! Er war vertraut mit jedem Atemzug seiner Frau, deshalb erkannte er den Ton sofort. Ungeachtet seiner schrecklichen Angst begann Lu in panischer Hast die Erde aufzuwühlen, in der wilden Hoffnung, daß hier ein furchtbarer Fehler geschehen sein könnte. Je tiefer er grub, desto deutlicher war das Stöhnen zu vernehmen. Seine Finger bluteten, doch er spürte es nicht. Endlich konnte er den Sargdeckel öffnen und fand Henh an der Schwelle des Todes. Er zog seine Frau aus dem Sarg heraus. Ohne zu zögern warf er sie in den Sattel und galoppierte, im Arm den Beutel voller Silber, nach Chi, um Medizin zu besorgen. Man wollte ihn nicht das Dorf hineinlassen. Lu versuchte die Wachposten mit der Hälfte seines Silbers umzustimmen. Diese gewährten schließlich den beiden gegen zwei Drittel des Silbers Zutritt. Im Dorf suchte Lu nach dem Haus des Arztes. Unter Aufbietung seines ganzen verbliebenen Silbers flehte Lu ihn an, Henh zu retten. Lu hatte die unheilvollen Konsequenzen seines Handelns nicht bedacht. Er hatte sich angesteckt. Seine Frau und er selbst starben noch in der gleichen Nacht. Der Arzt verwendete das Silber, um das Begräbnis für die beiden auszurichten. Sie wurden in einem gemeinsamen Grab beigesetzt. Während die Erde darauf geschaufelt wurde, streuten die Leute Kalk und warfen eine Handvoll weißlicher Silbermünzen und einige Spielkarten hinab. Sicherlich lachte, drei Klafter unter der Erde, Lus Seele insgeheim. Bald darauf war die Epidemie in Hua Tat vorbei. Der durch sie ausgelöste Schrecken aber verblaßte erst nach vielen Generationen. Dort, wo Lu und Henh begraben liegen, erhebt sich heute ein Erdhügel, auf dem einige Sträucher und Dornenbüsche wachsen. Die Alten in Hua Tat nennen die Stelle das Monument ewiger Treue, die Jungen dagegen sprechen von dem Grab zweier Epidemieopfer.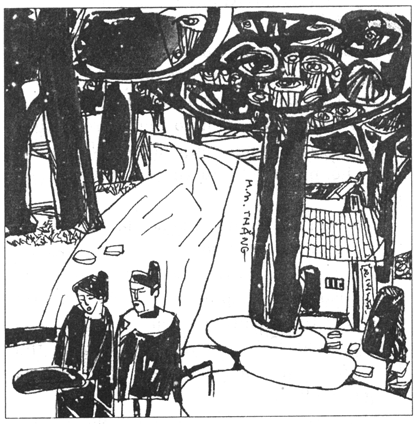
Die zehnte Geschichte:
Im Dorf Hua Tat lebte Sinh, eine Waise. Es hieß, daß
ihre Mutter einst von einem Geist verhext worden war und sie im Wald geboren
hatte. Sinh war sehr mager, sehr klein, und sah mitleiderregend aus. Nie bekam
sie einen guten Bissen zu essen oder etwas Schönes anzuziehen. Als Angehörige
der con huon29 lebte sie einsam wie eine Wachtel.
In Hua Tat, an dem Weg in den verwunschenen Wald, lag
ein kleiner Tempel. Dieser war Kho gewidmet, dem jungen Mann, der vor Zeiten
den schrecklichen Tiger getötet hatte. In dem Tempel lag auf einem Altar aus
Ziegeln ein kleiner Stein, so groß wie eine Menschenfaust. Der Stein glänzte
wie poliert, tief unter der Oberfläche durchzogen ihn winzige rote Adern wie
menschliche Blutgefäße. Wer einen Wunsch erfüllt haben wollte, umfaßte den
Stein und legte, mit den Lippen dicht daran, sein Anliegen ausführlich dar.
Seit vielen Generationen schon lag der Stein dort, er war Zeuge sehr vieler Lebenswege,
sehr vieler Schicksale. Er war zu einem heiligen Kultgegenstand30 geworden, und manche hatten schon gesehen, wie
der Stein nachts ein Licht ausstrahlte wie ein Stück Glut. Sehr viel Kummer,
sehr viele Wünsche hatten sich in dem kleinen Stein angesammelt.
Eines Tages kam ein Fremder aus dem Flachland herauf,
er war groß und ritt auf einem starken schwarzen Pferd. Er schaute beim
Dorfvorsteher vorbei, besuchte die Dorfältesten, hielt sich hier und dort und
überall auf, er begriff sehr klar die Sitten und Bräuche des Dorfes. Die
Einwohner von Hua Tat hielten ihn für einen Großhändler von Tigerknochen oder
seltenen Tierfellen. Er hatte sehr viel Geld und verhielt sich sehr ritterlich
und nobel.
Eines Tages ging der Besucher an dem Kho gewidmeten
Tempel vorbei, erblickte den Stein und versuchte, ihn in die Hand zu nehmen, um
ihn näher zu betrachten. Aber sonderbarerweise vermochte er aus irgendeinem
Grund nicht, den Stein von dem Altar hochzuheben. Verwundert rief er die
Dorfbewohner. Sie strömten um den kleinen Tempel zusammen. Der Besucher ließ
alle Leute der Reihe nach in den Tempel gehen und versuchen, den Stein
hochzuheben, aber keiner schaffte es. Der Stein war unheimlich schwer.
„Gibt es hier ein Geheimnis?“ fragte der Besucher. „War
denn wirklich jeder Dorfbewohner hier und hat versucht, den Stein hochzuheben?“
Die Überprüfung ergab, daß Sinh fehlte. Man hatte ihre
Abwesenheit gar nicht bemerkt.
Der Besucher forderte alle auf, Sinh zu suchen und
herzubringen. Sie war schon geraume Zeit unterwegs, um bei der Wasserquelle
maiKnollen31 auszugraben.
Sinh kam zu dem Tempel. Jeder machte ihr Platz. Der
Besucher sagte, sie solle versuchen, den Stein hochzuheben. Wie durch ein Wunder
hob Sinh ohne jede Anstrengung den Stein mit einer Hand empor. Jeder staunte,
alle stießen überraschte Freudenrufe aus.
Sinh bot den Stein dem Besucher dar. Das Sonnenlicht
schien auf die Hände des Mädchens, auf ihre Hände voller Schwielen, ihre
unförmigen Finger. Sinh rieb leicht an dem heiligen Fetisch. Da zerfloß
plötzlich der Stein vor aller Augen zu Wasser. Einige dieser Wassertropfen,
klar wie Tränen, fielen über die Hände des Mädchens hinab auf die Erde, wo sie
sternförmige Spuren hinterließen.
Der Besucher stand reglos, Tränenspuren auf den Wangen.
Er bat die Dorfbewohner, Sinh mitnehmen zu dürfen. Er erwarb für sie einen
neuen Rock und eine neue Bluse. Sinh verwandelte sich unvermutet in eine
außerordentliche Schönheit.
Am folgenden Tag verließ der Besucher das Dorf Hua Tat.
Man erzählte sich, Sinh sei sehr glücklich geworden. Der Besucher sei in
Wirklichkeit ein Kaiser gewesen.
Aus dem Tal von Hua Tat führt ein mit Steinen gepflasterter
Weg hinaus, ausreichend breit für einen Büffel, auf beiden Seiten gesäumt von
üppigem Pflanzenbewuchs, von me loi, Bambus,
Mangostan, Mangobäumen und hundert Arten von Lianen, deren Namen man nicht
kennt. Dieser Weg trägt den Namen des Mädchens Sinh.
Anmerkungen (in Normalschrift: von der Übersetzerin, in kursiv: vom Autor):
1 Vietnamesisch: dam, Längenmaß, 432 m.
2 Schwarze Thai: Minderheit im Norden Vietnams
3 Eine niedrige Bambusart
4 nou can: Im Krug gegorener Alkohol, wird zu Begrüßungszeremonien, Beratungen, traditionellen Festen getrunken.
5 Die Schwarzen Thai haben den Brauch, die Toten zu begraben oder zu verbrennen.
6 Aus Holz geschnitzte Symnbolfigur auf dem Dachfirst
7 Siedlungsgebiete kleinerer Ethnien in Nordvietnam
8 Musikinstrument einiger Bergvölker, Solo-Blasinstrument aus einem getrockneten Kürbis oder aus zusammengefügten dünnen Bambusrohren. Es wird gespielt, um eine Liebeserklärung zu machen.
9 Für den Schwiegersohn bzw. die jungen Eheleute bestimmter Teil des Pfahlhauses
10 Die Kinh oder Viet sind die mit 80% der Bevölkerung größte ethnische Gruppe in Vietnam. Die Mong oder Hmong sind eine ethnische Minderheit im Norden.
11 hon muoi: wörtl. "mehr als zehn"
12 So ein Tier gibt es nicht. Die lautmalerische Bezeichnung con don, con dim läßt an die ruckartigen Bewegungen und Richtungswechsel von Ameisen, kleinen Krebsen oder kleinen Muscheln denken.
13 Auf dem Rücken geragener Korb
14 Göttliches Wesen nach der Glaubensvorstellung einiger Ethnien im Norden Vietnams
15 eine Art wilde Kartoffel
16 Gestalten aus einer alten Sage: Abendstern und Morgenstern
17 Tanz der Thai in Vietnam
18 Bergbäche
19 Siedlungsgebiete kleinerer Ethnien im Norden
20 Göttliches Wesen nach der Glaubensvorstellung einiger Ethnien im Norden
21 nu dao chem da: wörtlich "wie ein Messer, das den Stein schneidet", bedeutet etwa: ohne zu zögern, ohne Bedenken, ohne Zweifel
22 wörtl. Saft aus (giftigen) Blättern der NgonPflanze
23 Siedlungsgebiet kleinerer Ethnien in Nordvietnam
24 Kleiner farbiger Stoff-Ball mit Bändern. Das
Federballspiel wird von mehreren Bergvölkern an Festtagen gespielt.
25 Tanz der Thai in Vietnam
26 Can Vuong, „dem König dienen“: Name einer vom damaligen vietnamesischen Monarchen unterstützte Widerstandsbewegung gegen die französische Eroberung (1885).
27 Nach vietnamesischer Auffassung sind die Eingeweide (gan ruot) der Sitz der Gefühle.
28 aus Holz geschnitzte Symbolfigur auf dem Dachfirst
29 niedrigste Kaste
30 thu ngau vat im Original, eine vieldeutige Wortkombination.
31 eine Art wilde Kartoffel
Nguyen Huy Thiep: Nhung truyen tinh yeu
[Liebesgeschichten], Hanoi 2004
übersetzt von Marianne Ngo
Veröffentlicht in: Viet Nam Kurier 3-4/2004, 1/2005 und 2/2005